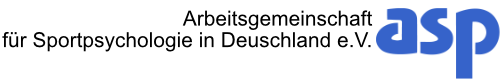Christian ist Sportpsychologe aus Leidenschaft. Mit ihm tausche ich mich über seine Herangehensweise in der sportpsychologischen Beratung aus. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Gespräch....
|
Hör dir das Gespräch als Podcast an:
Abonnieren auf: Apple Podcast • Castbox • Deezer • TuneIn |
Transkript des Gesprächs mit Christian:
Hallo Christian. Vielen Dank dass du dir Zeit nimmst für ein Expertengespräch. Du bist Sportpsychologe und nicht nur im Sport, sondern auch im Businesscoaching und der Psychotherapie tätig. Wie genau bist du zur Sportpsychologie gekommen?
Hallo Yvonne, schön dass wir sprechen. Ja, ich bin zur Sportpsychologie kommen damals über eine akademische Seite. Das heißt ich habe nach meinem Studienabschluss in Psychologie mich eben wissenschaftlich mit Sportpsychologie beschäftigt und da auch promoviert und bin dann über diese Forschungsseite im Grunde in die angewandte Sportpsychologie so ein bisschen reingeraten.
Zu welchem Thema hast du denn promoviert?
Über Selbstführungsfähigkeit.
Was verstehst du unter Selbstführungsfähigkeit?
Ich habe mir angeschaut wie erfolgreiche Athleten sich selber führen, organisieren und motivieren und das hat mich fasziniert. Im Grunde aus einer eigenen biografischen Beobachtung. Mein Cousin hat sehr gut Tennis gespielt, also ja genau, er war sicherlich deutsche Spitze, also schon jetzt nicht international gut aber deutschlandweit gut und das hat mich fasziniert, weil der hat schon in dem frühen Alter, also mit 7 oder 8 Jahren war der schon total fokussiert und mich hat es fasziniert wie das sein kann.
Was war dann so deine Erkenntnis, wie kann das sein, dass jemand schon mit 7 Jahren so fokussiert ist?
Also ehrlich gesagt, bei ihm wusste ich es auch nicht so genau, wie das so früh ist, aber ich konnte immerhin in der Dissertation schon rausfinden, dass es so ein paar Strategien gibt, die natürlich irgendwie auf der Hand liegen. Also diejenigen die sich besser selbst führen die haben klarere Ziele z. B. und die wissen genauer wo Stolpersteine liegen. Die sind beharrlicher. Also manches von dem war irgendwie vielleicht ja auch klar. Anderes und das war vielleicht auch ein bisschen überraschender, war, dass die Leute, die wirklich sehr erfolgreich waren, das bedeutet, die Leute die Medaillen gewannen, die haben vor allem sich dadurch ausgezeichnet, dass sie wussten, wo Sie Feedback herbekommen. Das heißt es gab eine klare Idee von denen, dass die genau ihr Umfeld auch kannten, wo die welches Feedback herbekommen konnten. Bis hin zu, dass die wussten, zu der Person gehen Sie jetzt, wenn sie fachlichen Austausch brauchen. Zu der Person gehen sie eher, wenn sie emotionalen Support brauchen und so weiter. Also da gab es einen ganz bewussten Prozess und es konnte auch zeigen, dass die sehr guten Leute sich sehr bewusst ihre Trainingsgruppen aussuchen.
Also das Umfeld so zu gestalten, dass es motivierend ist und dass es Spaß macht, oder?
Genau. Es ist eine große Frage, finde ich, gerade für die Athleten die vielleicht früh schon sehr gut sind. Wie gestalten die das? Wie bleiben die eben unter einer gewissen Spannung? Und das bedingt ja manchmal auch, dass sie die Trainingsgruppe wechseln. Denn es ist natürlich verführerisch, dass ich sozusagen als dickster Fisch, kann man sagen, in so einem kleinen Teich bleibe und denke mir, ja super alle finden das super was ich mache. Aber zu erkennen, entweder ich erkenne selber oder aber jemand anders erkennt es. Und dann ist ja die spannende Frage, folge ich dem? Also in welchen Modus gehe ich dann? Gehe ich in so einen Rechtfertigungsmodus und sag, nee der spinnt oder so oder bin ich auch mutig und sag, oh okay interessant, wo kann ich mich weiterentwickeln? Was brauche ich da?
Genau, das ist wie es Carol Dweck nennt, ein dynamisches Selbstbild.
Genau.
Dass ich mich weiterentwickle und nicht stehen bleibe, sondern immer weiter gehe.
Genau, also ich hab das damals jetzt noch nicht so genannt, aber ich glaube tatsächlich, also das was sie so hat, mit diesem Fixed und Growth Mindset wäre auf jeden Fall einen Punkt für ein Growth Mindset, weil das ja sozusagen wie so eine Art choice point wäre, wo man wieder so ist und sich entscheidet, wie gehe ich irgendwie von dem Punkt weiter?
Ja und das ist glaube ich auch eine Frage, weil ich denke, also gerade Sportler die halt sehr erfolgreich sind, die machen ja auch immer wieder das gleiche, stundenlang. Also egal welche Sportler, aber es gibt ja immer wieder die gleichen Trainingsabläufe und auf Dauer kann das ja auch langweilig werden und da ist es natürlich gut, dass ich einfach ein gutes Umfeld habe, damit es weiterhin auch Freude bereitet.
Für alle Seiten. Also ich finde das total spannend, auf allen Ebenen immer zu gucken, wann nutzt sich was vielleicht auch ab? Wann merke ich auch selber, dass ich so ein bisschen einen Zenit überschritten habe? In der Art der Ansprache, die ich habe auch in meiner Rolle aus dem Staff heraus? Das sind natürlich manchmal schwierige Prozesse, weil nicht immer ist es ein Prozess der jetzt von allen geteilt wird. Also manchmal ist es so, dass alles irgendwie ganz harmonisch läuft und man aber dann doch selber erkennt, Mensch so ganz kommt man da jetzt nicht mehr durch? Ja also ich hab letztens mit einem Schiedsrichter gesprochen, der ist ganz ganz lange dabei und da ging es auch so ein bisschen ums in der Hand haben vom Karriereende. Und das ist ja ein Punkt wo man sagen kann, es gibt nur wenige große Sportler, die dieses Karriereende so ganz bewusst für sich in der Hand halten. Manchmal kommt es ja auch von außen, aber wenn wir uns ein bisschen erinnern, wer hat es irgendwie gut zu einem Kreis geführt für sich? Dann sind es nicht so viele.
Ja es war dann oft einfach so ein abruptes Ende wegen Verletzung oder so.
Oder eben ein Ende wo man sagt, weiß nicht, jetzt aktuelles Beispiel, Rafael Nadal. Klar sein Karriereende passt auch auf eine Weise zur Karriere, mit irgendwie einer Art Schmerzgeschichte, auch das Ende irgendwie schmerzlich und irgendwie dann doch noch mal und doch noch mal. Auf eine Weise dann auch wieder stimmig und kongruent. Ich glaube vielleicht auch für ihn stimmig, so wie er sich angehört hat. Ja und so finde ich muss es jeder Sport so ein bisschen für sich klarkriegen. Was brauchts da zum Ende hin? Und gerade diese ganz großen Sportler. Ist auch gar nicht so leicht, die haben ja oftmals niemand mehr der Ihnen jetzt irgendwie gut Feedback geben kann. Das wird immer weniger.
Ja, weil irgendwie die Spitze wird halt immer enger.
Die wird enger und wer nimmt sich jetzt raus, keine Ahnung Herr Nadal oder Herrn Federer zu sagen, du das war's glaube ich?
Ja schwierig.
Sehr schwierig ja und ich find aber eben, es gibt auch immer wieder Beispiele wo man sagen kann, ja ist interessant. Wie wird's gestaltet? Und das kann eben ja auch dieser Punkt sein. Dynamisches Selbst? Fixiertes Selbst? Wie entwickle ich mich da irgendwie weiter? Wie offen bin ich da? Wie ehrlich bin ich da mir selbst gegenüber?
Ja das war jetzt so deine Promotion. Hast du dann auch schon in der angewandten Sportpsychologie gearbeitet oder wie ging dann dein Weg weiter?
Mein Weg war eigentlich ein sehr mühsamer würde ich sagen. So in den letzten 20 Jahren. Der führte halt über alle möglichen Dörfer oder auch über alle möglichen Umwege. Ich habe glaube ich, unglaublich viele verschiedene Sportarten betreut, von Minigolf bis Rollstuhl-Curling, Handball, Fechten, also eine ganz große Bandbreite. Das hatte halt damit zu tun, dass ich dann nach der Promotion eigentlich relativ fix alle, sozusagen mein berufliches Leben direkt dann voll auf diesen Bereich Sportpsychologie ausgerichtet hatte und es hatte auch damit zu tun, dass ich dann eben gucken musste, wie komme ich irgendwie gut über die Runden? Und somit war ich jetzt gar nicht in der Position, dass ich jetzt groß hätte sagen können, nee das mache ich jetzt nicht oder das mache ich jetzt auch nicht. Und so sammelte sich eigentlich irgendwie ein großes Sammelsurium an verschiedenen Sportarten. Ein bisschen prägt mich das jetzt bis heute, dass ich sagen kann, ich glaube ich habe so einen ganz breiten, ganz viele Sachen gesehen. Ich habe aber dafür glaube ich keinen ganz klaren Schwerpunkt. Es gibt andere Kollegen, die ja klare Schwerpunkte haben auf Teams oder bestimmte Sportarten. Das habe ich gar nicht so.
Es hat ja auch bestimmte Vorteile, dass du zwischen den Sportarten wechselst. Die Themen sind ja mehr oder weniger dann wahrscheinlich ähnlich, oder?
Total. Also die Themen glaube ich schon. Ich glaube die Kultur in den Sportarten ist dann doch sehr unterschiedlich. Also um so ein klassisches Beispiel zu nennen, eine Kultur in Beachvolleyball unterscheidet sich sehr stark von der Kultur im Rudern. Also rein wie die Menschen miteinander kommunizieren? Wie die Sportart auch irgendwie funktioniert? Mit den äußeren Gegebenheiten? All das. Ich glaube immer noch, dass es ein riesiger Unterschied ist, auch überhaupt natürlich Einzel oder Team. Aber im Einzel, dann noch mal speziell finde ich Kampfsportarten und aus meiner Sicht, klar da mag ich jetzt irgendwie finde ich ein bisschen durchs Fechten geprägt sein. Ich würde fast schon sagen, dass bewerte ich jetzt ein bisschen. Die Ego-Orientierung ist in Kampfsportarten ohne Buddhismus oder ohne fernöstliche Philosophie noch stärker. Also mein Eindruck ist, habe ich nur ganz wenig Einblick, aber mein Eindruck ist, dass es zum Beispiel Judokas oder so total hilft, dass sie eben so eine Grundhaltung haben, dass es eben nicht darum geht jemand zu vernichten oder was auch immer, sondern dass es egal wie stark der Kampf ist, eben Formen gibt und Rituale gibt, die schon viel länger da waren als sie selber. In der Art. Also beim Fechten gibt es schon auch, wie man sich grüßt und alles und so. Aber wie auch immer, bei den Judokas hat mich das halt beeindruckt, wie sie dann doch durchzogen sind von dieser, wie soll ich das sagen, von der Kultur oder von der Historie.
Ist es dann so ein respektvollerer Umgang?
Ja! Vielleicht überhöhe ich das jetzt, aber von der Grundhaltung her brauche ich den anderen, um überhaupt den Kampf zu machen. Also so “I am because you are”, mehr beide sind wichtig und es kann ein schwerer Gegner sein, aber beide sind wichtig. Und du hast jetzt in anderen Sportarten, die vielleicht nicht so überladen oder beladen sind mit solchen Philosophien wie Boxen oder Fechten, eher die Idee, ja das ist der Gegner, den muss ich schlagen.
Okay.
Es macht einen großen Unterschied im Selbst. Wie blicke ich da drauf? Also blicke ich da drauf, im Sinne von, Hauptsache gewinnen? Mir egal, Hauptsache ich gewinne irgendwie? Oder blicke ich drauf, im Sinne von,das Ziel was ich habe ist eher der Wettstreit, der Wettkampf, weniger, dass ich am Ende gewinne. Mir macht es Freude in dem Wettstreit zu sein und ich denke, langfristig gesehen ist diese zweite Haltung viel viel nützlicher als die erste Haltung, dass ich nur dann gut bin, wenn ich gewinne.
 Bekomme in regelmäßigen Abständen Mentale Trainingstipps für mehr Selbstvertrauen und Motivation!
Bekomme in regelmäßigen Abständen Mentale Trainingstipps für mehr Selbstvertrauen und Motivation!
- 22 wissenschaftlich erprobte Techniken
- Ziele setzen und erreichen
- Selbstbewusstsein stärken
- Motivation besser zu werden
- Entspannt und mit mehr Freude fliegen / Sport treiben
=> Zu den Mentalen Trainingstipps anmelden
Gut, dass du das sagst, weil auch in meiner Beratung versuche ich Athleten, Sportler, Piloten weg von dieser Leistungsorientierung zu bringen. Denn die Leistungsorientierung schwingt eh immer mit. Ich versuche sie eher hin zu Lernorientierung, Prozessorientierung zu bringen. Welche Haltung brauche ich um eben gut zu sein?
Ich finde eben auch, welche Haltung brauche ich um gut zu sein und welche Haltung ermöglicht mir auch an meine Grenze zu gehen, dass ich eben auch scheitern darf?
Weil das ist eben, also Scheitern in Anführungsstrichen, das gehört ja mit dazu. Ich werde ja öfter verlieren und wie gehe ich irgendwie jetzt damit um? Wie kann ich daraus eine Lernchance machen für mich? Und die Haltung finde ich schon langfristig sehr nützlich.
Das ist einerseits das Scheitern aber andererseits auch gewinnen. Also ich habe da mal ein Interview geführt mit einem sehr erfolgreichen Gleitschirmpiloten, also der hat jetzt sieben oder acht Mal an den X-Alps teilgenommen und jedes Mal gewonnen und den habe ich dann mal gefragt was ihn denn eigentlich motiviert dranzubleiben? Weil eigentlich hat er ja nur was zu verlieren. Also jedes Mal wenn er teilnimmt, ist das Risiko, dass jemand anders ihn schlägt. Also könnte man ja sagen die Motivation ist gar nicht mehr da, ich gebe einfach auf, ich lasse es, ich habe jetzt X Mal gewonnen fertig. Aber er hatte dann gesagt, ja er hat festgestellt, dass es noch nicht perfekt war, es gibt noch Stellschrauben, wo er mit seinem Team noch besser sein könnte und das motiviert ihn da weiterzumachen. Also es war noch nicht perfekt. Also im Prinzip steht da ja dann auch der Prozess im Vordergrund und nicht das Ergebnis.
Ja und ich würde sagen, ein Thema was auch noch mit reinkommt ist Wert vs. Ziel.
Also man könnte sagen, ein Wert könnte Professionalität sein. Ein Wert könnte auch finde ich, Perfektion sein. Ist ja schon denkbar als Wert. Aber das ist schon was ganz, diese Perfektion lässt sich natürlich nie vollständig erreichen eventuell. Ist so völlig okay, aber das ist irgendwie mein Anspruch, mein Wert und dass das Ziel ist, ich will jetzt X-Alps gewinnen, okay schön ja, aber das kann es natürlich für ihn nicht mehr sein, weil er hat's ja schon fünf Mal gewonnen ja.
Das ist eben, er hat Gleitschirmfliegen durchgespielt - mehrfach. Was ihn da antreibt? Die Freude an dem perfekten Flug und das ist ja auf jedes Mal aufs Neue wieder, sich der Herausforderung auszusetzen so und ich glaube diese innere Freude, die hat man ja immer finde ich mit Athleten, wenn man sie daran erinnert, wie sie mal begonnen haben. Das heißt, als sie begonnen haben, hat ja dieses ganze Thema oder so oftmals noch nicht so diese ganz große Rolle gespielt, erst dann als sie da besser wurden und älter wurden. Dieses zurückbringen auf diese innere Freude des Handelns oder des Machens, das finde ich immer was ganz Wesentliches.
Ja ich finde das auch, da hatte ich letztens in der Intervision auch, haben wir geredet, so über diesen Selbstwert von Sportlern und ich glaube, wenn ich eben so gewinnorientiert bin, dann ist halt mein Selbstwert auch sehr fragil, weil wenn ich gewinne, klar ist mein Selbstwert ganz hoch, aber wenn ich verliere, dann ist mein Selbstwert ganz schnell ganz unten. Und wenn ich eben eher so den Prozess sehe, den Lernprozess, dann ist ja auch der Selbstwert, also bleibt eher stabil.
Ja ja genau. Ja da habe ich es einfacher genau zu sehen wo mache ich Fortschritte? Wo geht's vielleicht auch zurück? Was auch immer halt. Ja klar.
Genau ja.
Nicht so abhängig.
Wir haben jetzt viel über Wert gesprochen, das ist ja schon auch ein Kernfaktor von ACT, also der Akzeptanz- und Commitment-Therapie mit der du auch arbeitest. Gibt's noch weitere wichtige unerlässliche Faktoren aus dem Konzept
Na unerlässlich weiß ich nicht. Ich finde halt die Grundhaltungen von ACT hilfreich. Jetzt auch eben für Betreuungen im Sport. Eine davon ist ja, sich irgendwie vom Leid des Lebens nicht abhalten zu lassen, das Leben zu leben was man leben möchte so. Und die finde ich total gut, weil das passt sehr gut, weil ja die Sportler auch vom Leid des Verlierens oder so sich auch nicht abhalten lassen sollten, genau in die Richtung zu gehen die sie möchten. Punkt eins. Und ich glaube schon, dass jetzt in dem Hexaflex ein paar Kompetenzen angelegt sind, die sehr hilfreich sind für Leistung. Klar eines ist sicherlich Präsenz, also Gegenwärtigkeit, Fokus, im Hier und Jetzt bleiben. Das halte ich schon immer für sehr wesentlich, weil Leistung ja immer im Hier und Jetzt stattfindet. Am Ende finde ich kann ich immer wieder Prozesse jetzt aus dem Hexaflex zurückbeziehen und das gibt mir halt viel Sortierung, sage ich mal so. Es ist für mich halt so ein roter Faden, genau. Ob es jetzt den Sportlern in gleicher Weise hilft, das hoffe ich eigentlich, das weiß ich manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich würde schon sagen mir hilft es enorm ja.
Ja, also sehe ich genauso. Ich arbeite jetzt auch schon einige Jahre mit ACT und finde es für mich selber sehr hilfreich. Du sagtest präsent sein, im Hier und Jetzt sein, ist extrem wichtig. Das sehe ich genauso und ich habe deshalb eine Achtsamkeitsausbildung gemacht und ich fand es dann sehr interessant, weil hier scheiden sich die Wege. Die einen sagen, wenn ich Achtsamkeit trainieren will, dann sollte ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Achtsamkeitsmeditation machen. Bei meiner Achtsamkeitsausbildung hat der Trainer gleich zu Beginn gesagt, er würde das selber nie machen und würde es auch von seinen Klienten nicht erwarten und der Meinung bin ich auch. Ich finde, man muss es schon trainieren, aber es muss nicht täglich sein und dann eine halbe Stunde oder Stunde, sondern es sollte so im Alltag integriert werden. Wie siehst du das?
Ich finde auch, also ich sag mal so, ich würde eben auf so Kernmerkmale referenzieren und sagen, naja ACT propagiert das psychische Flexibilität ein Merkmal ist wo sich psychische Gesundheit abbildet. Wenn ich das umsetze, dann tue ich mich eh schon schwer, mit so einer Regel, ihr müsst es so tun und nur so kann es wirksam sein. Das finde ich schon, weiß ich nicht, nicht so voll einsichtig für mich. Punkt eins. Und zum anderen würde ich sagen ACT ist halt eine Verhaltenstherapie und ein Kern von ACT ist jetzt nicht nur im Hier und Jetzt sein, sondern Commitment ja. Und das bedeutet eben, dass es um Handeln geht, ums Tun. Und dann wäre ich ja auch wieder so beim Alltag und bei der Lebenswirklichkeit von den Sportlern und wenn mir das nicht gelingt, eben das was ich da vermitteln will, in die Lebenswirklichkeit von denen zu bringen, tja dann ist es halt schwierig. Und wie viel Dosis es braucht, schwer zu sagen. Gibt's ja auch verschiedene, glaube ich, Forschungsbefunde, darf man nicht unterschätzen, dass es wirklich eine regelmäßige Praxis braucht, aber ich bin jetzt immer mehr dazu übergegangen das mehr so Richtung social mindfulness zu lösen. Also ich mache so Achtsamkeitsübungen vermehrt gemeinsam, also das heißt ich lass nicht viel eigentlich alleine üben, sondern mehr im Dialog zum Beispiel. Also dass wir im Dialog benennen, was wir sehen oder hören oder spüren oder dass wir im Dialog bemerken, wo sich unser Geist befindet. Solche Sachen. Und ich erlebe das eigentlich als eine viel motivierendere Form des Übens, also des gemeinsamen Tuns, als wenn ich jetzt nur sagen würde, bitte gehe in diese oder jene meditative Grundhaltung und halte diese für eine bestimmte Zeitspanne jeden Tag ein. Ja genau, also es ist ein großes Thema eigentlich, gerade so dieses Thema so hinzubiegen, dass es irgendwie handhabbar ist für die Sportler, dass es irgendwie kleine Übungen sind, die sie auch nachvollziehen können, die sie umsetzen können, weil eben am Anfang es diese Kontraintuition gibt, dass manches ja so einfach vielleicht klingt oder wirkt. Also wenn ich jemandem sag, so ist jetzt irgendwie wichtig in so einen achtsamen Dialog zu treten. Da sagst du was du siehst und was du hörst und was du denkst und fühlst und was dir wichtig ist. Dann sagt er, ja gut, was soll jetzt das? Im ersten Moment.
Aber diese Transferleistung, glaube ich, da bin ich auch immer wieder gefordert, aber das halte ich schon für wichtig. Aber ich habe keine feste Regel, wo ich sagen würde, ich verpflichte meine Sportlerin zu der und der Übungszeit.
Welche Ansätze oder mit welchem Beratungsansätzen arbeitest du denn sonst noch?
Na ich bin von der Grundausbildung, komme ich eigentlich aus der systemischen Therapie, das heißt die erste therapeutische Weiterbildung, die ich gemacht habe, war eine systemische und es ist immer noch so, dass egal, dass ich jetzt später mich jetzt in Verhaltenstherapie probiert habe, es ist immer noch so, dass die Grundhaltung für mich sehr systemisch ist. Also so diese Idee des Konstruktivismus, das eben Wirklichkeit aus der subjektiven Betrachtung oder aus der Subjektivität heraus passiert und entsteht und die Welt in dem Sinne im Kopf entsteht, die prägt mich immer noch und mich prägt auf jeden Fall, dass ich sagen würde, ich sehe ja viele meiner Klienten mehr als Experten, als jetzt mich und sie darin zu begleiten, was sie eben jetzt zu den Experten macht, finde ich immer noch wesentlich für mich. Das heißt wenn ich jetzt Ansätze habe, die ich verwende, dann sind es schon auch noch so klassisch lösungsorientierte Ansätze, die mir halt helfen auf die Sachen zu gucken die funktionieren und auch den Blick halt zu schärfen, für das, was jemand eben trotz der ganzen Schwierigkeiten kann.
Das ja auch kein Widerspruch zu ACT also.
Gar nicht. Also genau, ich finde eben irgendwie immer gut kombinierbar für mich mit ACT. Manches ist irgendwie ganz ähnlich, ja würde man genauso machen, anderes ist vielleicht ein bisschen radikaler, jetzt systemisch gesehen. Aber ja ja genau, also vieles was an Diffusionstechniken oder so in ACT vorgeschlagen wird, ist ja genau kongruent mit klassischen systemischen Sachen, wie Reframing oder ja, genau solchen Techniken, oder halt irgendwie Außenperspektive einführen oder sowas ja. Genau also weil wäre ja ACT konform, würde man in der systemischen Therapie auch sagen, dass es nicht darum geht die Gedanken zu verändern, sondern die Wirkung der Gedanken auf die Person, auf die anderen, ja und das wäre ja klassisch eigentlich genau der gleiche Umgang den ACT jetzt mit Gedanken oder Gefühlen hätte. Ein Systemiker würde auch nie sagen, ja die Gedanken sind das Problem und die Gefühle sind das Problem. Er würde sagen die Auswirkungen der Gedanken oder der Gefühle sind, daraus entsteht ein Problem. Ja genau, also von daher finde ich das total gut.
Ja ich fand es auch interessant, also ich habe auch bei Russ Harris mal so eine Fortbildung gemacht und da kamen dann auf einmal auch Fragen, die ich eben so aus dieser lösungsorientierten Therapie aus kenn. Da kam dann auch mal die Wunderfrage, wo ich mir gedacht habe, hm die gehört ja eigentlich woanders hin, aber der verwendet die genauso. Also von daher, ja passt es einfach gut zusammen.
Genau, genau und ich finde eben, also was mir halt an ACT schon auch gut gefällt, das mögen andere Leute jetzt anders sehen, aber mir selber gefällt, dieses eher so pragmatisch eklektizistische, auch sehr pragmatische, dass man eben da auch manches eben integriert und viel auch wieder auf Nützlichkeit prüft. Ich finde das gut. Ich sehe das nicht gern so dogmatisch. Ich feier es ja immer noch, dass eben ACT jetzt eben nicht diesem Drang unterworfen ist, dass irgendwie jetzt alle Leute sich zertifizieren müssen oder weiß ich nicht oder dass es dann halt einen ACT-Therapeuten gibt, die anderen sind alle keine ACT-Therapeuten.
Ja das hat einerseits einen Vorteil finde ich auch, weil man sich halt ständig irgendwie weiterentwickelt und weiter schauen kann. Auf der anderen Seite, also ich habe mit meiner Kollegin dann auch schon mal drüber gesprochen und die dann, ja aber woher weiß ich dann, dass ich jetzt wirklich qualifiziert bin für ACT?
Ja ist schwierig ja.
Das ist dann halt die andere Seite der Medaille.
Total. Ja ich glaube Extrempositionen sind immer schwierig. Sie haben sicherlich da jetzt eher eine extreme Position gewählt oder auch eine Position von Offenheit, würde ich so sagen, ja mit all den Schwierigkeiten, die sie sich da dann wiederum einhandeln ja.
Ja ist so.
Aber ja ich würde sagen es ist so. Ich finde es eben in Abgrenzung letztlich zu fast allem was ich jetzt aus dem psychotherapeutischen Kontext kenne an Weiterbildung, finde ich es wohltuend, weil alle anderen Sachen, die ich irgendwie so mache oder höre haben ja eher das andere Extrem. Es gibt die und die Zertifizierungsrichtlinien, das und das muss ich da irgendwie dann wieder erfüllen, den Baustein und den Baustein.
Ja das stimmt.
Ja genau. Aber ich will es jetzt gar nicht so, weiß nicht, gar nicht so bewerten. Am Ende ja macht man das und.
Und gut ist.
Ja viel ist ja auch davon geprägt wie du auch schon gesagt hast, wer hats irgendwie wie vermittelt? Da gibt's sicherlich auch noch mal Unterschiede.
Ja, sie sagen ja auch es ist offen und ACT lässt sich ja auch mit allen herkömmlichen Formen irgendwie kombinieren. Also ich arbeite auch viel mit Embodyment und dem Züricher Ressourcenmodell und das finde ich passt perfekt in ACT mit rein.
Voll genau. Also meine Haltung wäre mehr so, dass ich sagen würde. In Anführungsstrichen, was fehlt? Also ich glaube, dass wenn du jetzt jemanden hast, der eine starke und gute lösungsorientierte Therapie macht, das kann total stark sein. Da könnte aber wiederum dieses, sage ich mal, körperorientierte Element so ein bisschen fehlen. Und so kann man es finde ich ganz gut eher gucken, ein bisschen, was irgendwie würde noch gut tun? Und mir selber gefallen ja viele ACT Übungen auch deswegen, weil sie eben auch viel stärker aufs Erleben gehen und viel weniger, was ja sozusagen finde ich ein kleine Kritikpunkt an der systemischen Therapie ist, es ist immer wieder auch eine stark kognitive Therapie. Also wenn ich auf die Interventionen schaue, was die systemisch Therapie so klassischerweise anbietet, sind es im Schwerpunkt kognitive Interventionen, Frageformen und so weiter.
Imaginationen, Arbeit mit Metaphern, das bedeutet, dass, ich finde aus meiner Arbeit, ich brauche immer wieder Menschen, die wollen auch extrem in so eine Selbstreflektion gehen und die eben auch Lust haben mit dem Kopf da zu arbeiten und ACT hat da finde ich eine gute Ergänzung, weil das dann auch ums Spüren geht, ums Erleben geht, auch ums Tun geht. Da finde ich das schon ganz gut.
Ja, jetzt haben wir viel über ACT geredet. Mich würde noch interessieren, du hast ja ganz viele Sportarten begleitet und was waren denn so immer die Hauptthemen, die kamen? Du hattest ja vorhin auch gesagt, die Themen waren ja immer ähnlich. Was sind denn so die Schwerpunktthemen, die du so in der Beratung angetroffen hast?
Naja, also das unterscheidet sich von vielen Faktoren, manchmal auch ein bisschen zu welchem Zeitpunkt in der Saison treffe ich ein Team oder Sportler. Ich finde, darf man nie vergessen, dass die Sportler ja eingebunden sind in bestimmte Saisonhöhepunkte, das macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt drei Wochen vor einem Höhepunkt mit dem Sportler beginne zu arbeiten oder ob ich schon, keine Ahnung, in der Sommerpause irgendwie starte und so unterscheiden sich natürlich auch irgendwelche Themen. In dem Sinn, ich denke schon, dass auch Themen Unterschiede sind, ob du jetzt eine Mannschaft betreust oder ob du Einzelsportler betreust. Denke schon, dass in der Mannschaft dann auch viel mehr diese Dynamiken eine Rolle spielen, auch viel mehr klassische Team-Entwicklungsprozesse eine Rolle spielen könnten. Wie wir als Gruppe eben agieren? Wie wir irgendwie dort zu einer guten Einheit kommen? Und so weiter. Also das finde ich schon noch mal ein Unterschied, den ich so in dem Einzelsport nicht habe, wo es dann mehr um so Themen geht wie Nervosität oder mentale Wettkampfvorbereitung oder so. Aber selbst da ist ja das, dass ich sagen würde, auch das ist ein bisschen kontraintuitiv zu ACT, wenn jetzt ein Sportler kommt, dann würde der ja oftmals von mir verlangen, dass ich ihm irgendwelche Kontrollstrategien an die Hand gebe für Gedanken oder Gefühlszustände und da jetzt erstmal irgendwie so eine Enttäuschung vorzunehmen, die da heißt, ne also Kontrollstrategien vermittle ich gar nicht.
Wie geh wie gehst du damit um? Das habe ich nämlich auch immer, also zu mir kommen viele mit Ängsten und ich sag dann immer ja so diesen Zauberstab, um die Angst wegzubekommen oder zu kontrollieren habe ich nicht und dann ist erstmal.
Genau ja ich finde, ich gehe jetzt damit um, dass ich schon, ich sag mal so, ich finde da brauchts schon mal auch eine ganz gute Edukation. Also den Leuten auch zu vermitteln, dass eben so eine Kontrollstrategie, die sie da fahren, dass das irgendwie in vielen Bereichen Ihres Lebens gut funktioniert hat aber eben für Ängste weniger gut funktioniert. Ist ja erst schon mal ganz hilfreich also, dass jemandem klar ist, okay das, was ich jetzt irgendwie will, hat ja ein Wert gehabt oder ein Effekt gehabt in meinem Leben. Jetzt für dieses Phänomen Angst, da hat es jetzt nicht so gute Effekte ja und ich glaube da brauchst du glaube ich erstmal Verständnis, dass jemand sieht, okay die Strategie, die ich da angewandt habe geht da halt nicht, jetzt braucht's was anderes. Und so würde ich sagen, versuche ich das manchmal so ein bisschen aufzuweichen. Ja in kleineren Schritten, zumindest dieses Denkmodell, dass die Angst gehen soll oder kleiner werden soll oder ja. Aber ja genau, also natürlich ist es kontraintuitiv für die Sportler, dass jetzt jemand sagt, ja nee Kontrollstrategien vermittle ich dir nicht. Ja was vermittelst du denn dann stattdessen? Ja und da würde ich eben sagen, falls da nach so Themen gefragt würde, sagen Ziele sind ähnlich. Die Ziele sind ganz oft, hilf mir meine beste Leistung in dem Moment zu zeigen, wenn es zählt? Also ich denke das ist übergreifend.
Also so nach Eberspächer, gut sein, wenns drauf ankommt.
Absolut das würde jeder Sportler unterschreiben. Der Weg dorthin ist halt unterschiedlich und ein paar Prinzipien bleiben aber schon ähnlich, will heißen es ist wahrscheinlich ein Holzweg zu glauben, ich will irgendwas ausschließen, ausgrenzen, bekämpfen, vernichten, das wird weniger funktionieren und manchmal ist es auch so, dass sicher auch, vor allem auch emotionale Zustände sich nicht vermeiden lassen. Also ich werde nie vergessen also eine meiner schönsten Geschichten war, ich war 2016 bei Olympia für ein Beachvolleyballteam und bin dann heimgeflogen und saß im Flugzeug neben dem indischen Sportpsychologen. Also zu zufällig, wir saßen halt nebeneinander und diese indische Sportpsychologe, der hat die Schützen betreut und der hat dann gesagt, ja also er muss echt sagen, er hat versagt. Dann hat er gesagt, ja seine Athleten, die können halt einfach nicht mit dem Druck umgehen und ihnen ist es halt einfach nicht gelungen und dies. Okay ich kürze es ab, im Verlauf des Gesprächs kam raus, ach ja und er hatte, er hat gesagt es liegt vor allem daran, dass die Athleten in der Finalrunde also, wenn es dann darum geht von den Top 8, also aus den Top 8 werden die Medaillengewinner. Und er hat gesagt bis zu den Top 8, alles gut, aber kaum gehts um die Medaillen, dann versagen die halt. Also jetzt pass auf, in dem Gespräch, stellt es sich heraus, dass ein Medaillengewinn in Indien generell, aber vor allem in bestimmten Provinzen, dazu führt, dass du wirklich sorgenfrei bist. Also das bedeutet, du kriegst so viel Geld und ein Haus, dass dein Leben wirklich, das kann man sich, das ist einfach radikal ein anderes Leben. Das bedeutet auch, dass die Sportler halt wissen, zwischen Platz 5 und Platz 3 liegt ein Leben ja.
Worauf ich gesagt habe, na gut das ist aber ganz schön Druck. Hat er gesagt, ja das ist das Problem.
Und das dann mal auszublenden ist gar nicht so leicht.
Total also ist ich würde sagen, das ist unmöglich.
Weil es ist ja eine Form, finde ich also, es ist ganz marxialisch, es ist halt, wie ein Spiel des Lebens und wenn du wirklich die Rahmenbedingungen so schaffst, ja das so maximal erhöhst, dass es ein Spiel des Lebens ist. Also von, du hast halt gar nichts, im Sinne von du lebst mit 30 Leuten in einem Raum oder du kriegst alles. Genau, ja dann ist es natürlich logisch, dass du da. Ich würde behaupten, da kann der beste Sportpsychologe der Welt kommen, aber es funktioniert nicht. Also es ist riesiger Druck.
Also so fand ich eine schöne Geschichte wo klar wird oder wo für mich klar wird, es geht nicht darum den Druck auszublenden, es geht auch nicht darum den Druck kleiner zu machen, es geht darum, präsent in dem Moment zu erkennen, erspüren, erfahren, das ist die Situation so, das passiert jetzt mit mir in dem Moment, diese Falle stellt mir mein Geist, diese Falle stellt er mir. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Was ist jetzt meine engagierte Handlung?
Genau das ist dann wieder das im Hier und Jetzt sein.
Genau im konkreten Fall des Schützen könnte das sein, ich erkenne ja genau, jetzt beginnt so eine gedankliche Spirale. Ja ich weiß, die engagierte Handlung ist, ich weiß was meine Routine ist, ich weiß, wie ich mich auf meine Atmung konzentriere, ich weiß was ich sozusagen fokussieren muss im Außen.
Ja genau. Wie können Sportler denn, sage ich mal, mit so Rückschlägen dann gut umgehen? Also wenn das dann einfach mal passiert ist? Man ist doch wieder super nervös geworden. Hat's nicht geschafft im Hier und Jetzt zu sein und hat jetzt ein Rückschlag erlitten. Wie können Sportler jetzt gut mit so einer Situation umgehen und haben eben ihr Ziel nicht erreicht?
Na ich denke es ist für Sportler und Trainer wichtig einen Raum aufzumachen, indem beide Seiten in einer guten Art und Weise auf sozusagen so ein Rückschlag blicken können und da sehe ich eben die Hauptverantwortung des Trainers darin, dass er A den Raum schafft, also den Raum der Sicherheit und des Vertrauens schafft, dass das möglich wird und B auch da eine hilfreichere Strukturierung gibt, zum Beispiel in Form von hilfreichen Fragen, die einfach helfen, bisschen Anleitung geben. Wie kann man irgendwie jetzt auf diesen Rückschlag oder Misserfolg blicken?
Ja ich denke es ist auch wichtig dann positiv zu reflektieren oder weil wahrscheinlich war ja nicht alles schlecht. Irgendwas war ja vielleicht auch gut.
Das stimmt. Es ist immer wieder eine Frage des Zeitpunktes. Also das ist sehr stark vom Timing abhängig, wie schnell es irgendwie möglich ist, in welche positive Richtung zu schauen. Manchmal geht es halt auch nicht immer gleich, weil die Enttäuschung halt so groß ist. Aber genau ja natürlich war nicht alles schlecht ja.
Und aber das ist eben klar auch Teil des Prozesses, aber ich würde sagen grundsätzlich ist erstmal eine Bedingung zu schaffen, wo überhaupt darüber reflektiert wird und das Reflektieren ist halt mehr als nur zu sagen, ja war halt Kacke, muss man halt jetzt nach vorne gucken.
Das hilft ja auch nicht wirklich.
Nee das hilft halt nicht.
Ja ich weiß nicht ob in deinen Sportarten auch, also Verletzungen passieren ja immer wieder, also egal ob das jetzt bei Ballsportarten ist oder beim Radfahren oder Skifahren oder egal was. Athleten verletzen sich und manchmal auch schwer und manchmal entsteht ja da auch so eine Art posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) daraus, vielleicht im Kleinen oder im Großen. Was wäre denn so deine Empfehlung, um da entgegenzuwirken, dass die vielleicht nicht entsteht oder wenn sie entstanden ist, wie können damit Athleten am besten umgehen?
Naja also ich würde sagen zunächst würde ich schon noch mal bisschen differenzieren wollen, zwischen traumatischer Situation und posttraumatische Belastungsstörung. Fürs Zweite müsste es ja wirklich irgendwie dann auch ein paar klinische Kriterien geben die dafür sprechen. Angefangen von Zeitkriterien bis hin zu Symptomkriterien, also das würde ich irgendwie mal so sagen. Ja gibt's die oder gibt's die nicht? Am Ende finde ich ist eine Verletzungssituation immer eine traumatische Situation, ob daraus jetzt eine Störung steht, finde ich, steht mal auf einem ganz anderen Blatt eigentlich und bedarf, weil du gefragt hast wie gehe ich damit um, würde dann im Einzelfall auch nach guter und erfahrener Diagnostik, finde ich. Da ist man erst mal ganz gut beraten, wenn man nicht genau weiß, gibt's jetzt Symptome von der PTBS oder gibt's die nicht? Da finde ich das schon gut. Also meine Faustregel würde heißen, wenn du ein Verdachtsmoment hast auf PTBS, dann lass es lieber sauber abklären, weil da finde ich ebenso mache ich das auch jetzt in dem in dem klinischen Arbeitskontext, das ist jetzt so der einzige Störungsbereich, wo ich konsequent verweise. Also es gibt keine andere Störung, wo ich so konsequent verweise wie da. Einfach nur aus meinem Wissen heraus, dass es eben wirklich ganz gute traumatherapeutische Methoden gibt. Aber ich finde gleichzeitig, man sollte halt über Erfahrung und Wissen verfügen in der Anwendung dieser Methoden und wenn ich jetzt da nicht so geübt bin, dann macht's auch keinen Sinn, dass ich dann sag, ja ich mache halt ein bisschen von dem, ein bisschen weißt schon ja. Das finde ich alles nicht seriös, also da finde ich irgendwie auch eine innere Klarheit gut. Wo gebe ich was hin? Ja genau und alles andere was irgendwie jetzt nicht klinisch wäre oder nicht krankheitswertig in dem Fall, im Sinne von der krankheitswertigen Diagnose, da glaube ich sind viele Dinge hilfreich die wir so ein bisschen aus der Sportpsychologie halt auch immer wieder anwenden. Strukturierungen, Orientierungen, einen Check zu machen, Inventur zu machen, einen Umfeldcheck zu machen. Wie kann das Umfeld unterstützen jetzt in dem Verletzungsereignis? Genau das sind halt so Sachen. Auch, finde ich, Edukation, um noch mal irgendwie klarzuziehen was für Phasen gibt's denn eigentlich nach so einem Verletzungsereignis? Ist denn eben so eine emotionale Down-Phase vielleicht irgendwie auch ganz normal? Wie lange hält die denn an so im Mittel? Solche Sachen, ja das finde ich ganz gut.
Okay.
Ich würde immer wieder unterscheiden eigentlich, zwischen eben einer Begleitung im Akutereignis der Verletzung, das find ich braucht noch mal was anderes als in der Begleitung im Rehaprozess. Und da würde ich wieder unterscheiden in der Begleitung, einmal sozusagen ready to practice oder ready to train? Und dann wieder so ein Haufen von ready to compete.
Ja da geht's darum wieder Selbstvertrauen aufzubauen.
Selbstvertrauen aufzubauen, ja. Es geht darum irgendwie zu überlegen, wie geht man so einen ersten Wettkampf an? Wann soll das sein? Und so allein schon in so eine sozusagen Untergliederung von so einem Verletzungsereignis in unterschiedliche Phasen, würde man jetzt so bedürfnisorientiert sagen, das hast du ja auch schon gesagt mit dem Ressourcenmodell, wenn man jetzt so Richtung Grundbedürfnisse sich überlegt, da ist man halt sehr bei so Kontrolle und Orientierung, das schafft es ja schon. Ja genau und dann habe ich ja schon mal wieder was Wichtiges hergestellt, was vorher total verletzt wurde, also bedroht wurde durch die Verletzung.
Und ich könnte es quasi auch so sagen, wenn ich es auf einer Grundbedürfnisebene sehe, dann bedroht die Verletzung quasi Kontrolle und Orientierung, aber gleichzeitig auch Bindung, weil ja meistens eben durch die Verletzung ein Rausreißen passiert, aus den gewohnten Trainingsstrukturen. Das bedeutet, die Leute, mit denen du vorher zu tun hattest ganz viel, die sind jetzt halt nicht mehr so präsent und da ist auch wichtig das halt auf dem Schirm zu haben, dass du eben dann guckst, okay wie kann das ausgeglichen werden? Wer kann jetzt Support geben? Wie kann man auch gucken, dass du trotzdem noch irgendwie Teil der Mannschaft ein bisschen bleibst und informiert bist? Wie geht's dir so damit? Solche Sachen ja.
Ja ich find das ist immer dann besonders dramatisch, weil wenn jemand verletzt ist, also wie du jetzt gerade gesagt hast, das soziale Umfeld fällt dann zum Teil weg. Die Gruppe fällt weg und das andere ist ja auch die Bewegung zum Teil.
Ja genau.
Ja weil Bewegung ist ja auch was, was Glückshormone und Neurotransmitter freisetzt und die fehlen dann auf einmal.
Ja genau. Also man muss sich halt klar machen, dass das Verletzungsereignis den Sportler halt von vielen Ressourcen abtrennt, die der halt vorher hatte. Das kann Bewegung sein, das kann Freunde sein. Das sind halt viele Ressourcen, die sofort wegfallen und dass das natürlich psychisch was mit einem macht ist ja klar.
Begleitest du viele Athleten auch in der Verletzungsphase, Rehaphase?
Viel würde ich nicht sagen, aber es tritt immer wieder auf. Ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass man da auch in den Standardprozessen Teil davon ist, dass man es überhaupt mitkriegt, dass es eine Info gibt eben, eine gute Vernetzung. Auch zu einer Physiotherapie zum Beispiel oder zu einer Medizin. Ja das finde ich schon ganz gut. Also oftmals hat man es ja noch nicht mal so gut auf dem Schirm. Also es ist so nicht immer überall Standard, dass es so ganzheitlich gesehen wird, das Verletzungserreignis.
Ja. Was sind denn deiner Meinung nach die häufigsten Fallstricke, psychologischen Fallstricke, über die Athleten, Sportler stolpern können?
Naja gut, eine häufige Falle wäre ja, es besonders gut machen wollen. Ja so gerade in dem Moment, dass man weiß es geht um was, also jetzt will ich besonders gut machen. Ein Fallstrick wäre auch, irgendwas auf keinen Fall fühlen zu wollen oder erleben zu wollen. Das glaube ich geht auch meistens schwierig.
Ja das geht dann so Richtung Kontrolle.
Also auch einfach ans gewinnen denken oder an die Medaille denken. Ja das wird wahrscheinlich weniger funktionieren. Ja genau, also das wären, finde ich so, alles bloß das nicht. Also auch natürlich schön ist auch sowas, also irgendwelche Zustände sich vorzunehmen, die auf jeden Fall nicht erreicht werden können. Also sowas wie an nichts denken, sozusagen so eine Art clear mind zu haben, während des Wettkampfs bei den Olympischen Spielen im Flow zu sein. Genau das halte ich halt alles für totale. Oder auch, also um jetzt mal ein bisschen was zu nennen, was vielleicht nicht gleich auf dem Schirm schon ist, auch so im Einklang mit seinen Werten zu sein oder im Eingang auch mit denen zu handeln und dann völlig konfliktfrei von allen akzeptiert zu sein, zum Beispiel.
Das klingt sehr utopisch.
Genau ist halt utopisch ja. Also, ich sag, es Bedarf immer wieder einer Priorisierung und die Priorisierung muss jetzt ja nicht unbedingt immer allen gefallen.
Ja ist wahrscheinlich zwangsläufig so, also wenn ich nach meinen Werten leb. Das sind halt meine Werte und damit stoß ich ganz automatisch bei anderen an.
Genau und das ist auch wichtig auf dem Schirm zu haben, wenn ich mich dafür auch entscheide, da irgendwie stärker in die Richtung zu gehen, dann bedeutet es auch, dass es eben Punkte gibt, die ich Aushalten muss und die für mich vielleicht manchmal auch schwieriger auszuhalten sind. So ist halt der Preis.
Genau das sind wir dann wieder bei ACT, bei der Akzeptanz, dass ich bereit bin das auszuhalten.
Genau ja, ich denke eben, das Leben besteht halt jetzt auch aus diesem Teil des Leidens oder so. Das gibt es halt und ich kann auch nicht so tun, als gäbe es das nicht.
Ja wir leiden alle in irgendeiner Art und Weise. Was ist denn so der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Insgesamt oder jetzt auch für eine Drucksituation?
Ich würde sagen insgesamt.
Insgesamt? Vielleicht sowas wie, du bist nicht allein.
Also wenn ich mich an eine schwierige Situation aus meinem Leben erinnre, dann erinnere ich mich, wie damals ein Lehrtherapeut, der hatte irgendwie zu mir den Satz so gesagt und er hat es ein bisschen ausgebaut und gesagt, er wünscht mir einfach, dass mit mir jemand läuft, so imaginär, der mich so mit an der Hand nimmt oder dass wir gemeinsam an der Hand laufen. Gemeinsam laufen und nicht alleine laufen. Ja und das finde ich manchmal ein schönes Bild. Irgendwie klar zu haben und klar zu sein, selbst wenn es sich irgendwie so anfühlt, man ist irgendwie, in dem Sinn nicht allein ja.
Ja das ist schön.
Und kann einem ein bisschen Ruhe geben.
Es gibt einem auch Sicherheit. So ich muss nicht alleine durchstehen, sondern es ist immer jemand da, der einen auch unterstützen kann.
Genau. Nicht immer sichtbar oder nicht immer klar, aber auch nicht immer verfügbar vielleicht aber grundsätzlich ist man nicht allein.
Ja sehr schön. So zum Abschluss hätte ich noch eine letzte Frage an dich und zwar wenn du eine kurze Nachricht an alle Menschen der Welt schicken könntest. Welche Botschaft würdest du gerne verbreiten wollen?
Ich finde es ist, es wäre ein großes Geschenk, sich mehr bewusst zu sein, jeder Einzelne, dass es doch viel mehr Wahlfreiheit gibt, als man zunächst glaubt.
Das ist doch ein schöner Ratschlag oder eine schöne Botschaft, weil wir haben alle Wahlmöglichkeiten jederzeit.
Genau, also es ist natürlich, ich glaube der Satz ist ein bisschen gemein, aber für uns jetzt, da wir irgendwie Glück haben und in einem relativ zivilisierten Teil Leben und jetzt nicht im Gazastreifen oder so, stimmt es glaube ich, dass wir irgendwie doch mehr Freiheit haben, als wir denken und ich finde immer wieder schön, sich dem bewusst zu werden.
Ja schön! Dankeschön Christian für das tolle Gespräch!
Was ist das Hexaflex und ACT?
Die ACT (Akzeptanz und Commitmenttherapei) ist eine Form der Verhaltenstherapie, in der es darum geht, unangenehme Gedanken oder Gefühle zu akzeptieren, anstatt sie zu unterdrücken oder zu vermeiden und engagiert nach den eigenen Werten zu handeln. Es hilft dabei die Lebensqualität zu verbessern und ein erfülltest, bedeutungsvolles Leben zu führen. Die 6 Kernfaktoren der ACT findet man im Hexaflex zusammengefasst, dazu gehören: Akzeptanz, Defusion, Kontakt mit dem gegenwärtigen Moment, Selbst als Kontext, Werte & Ziele und Engagiertes Handeln.
Gerade der Fokus auf das Hier und Jetzt zu lenken ist im Sport extrem wichtig. Bei der Akzeptanz geht es darum alles was ist anzunehmen und sich weniger von unangenehmen Dingen einfangen zu lassen. Bei der Defusion geht es darum sich von nicht-hilfreichen Gedanken und Gefühlen zu lösen und Distanz zum eigenen Denken zu bekommen. Unter Selbst als Kontext wird verstanden, dass wir in der Lage sind eine Beobachterperspektive zu sehen. Unter Werte werden grundlegende Überzeugungen verstanden. Kenntnis über die eigenen Werte hilft dabei ein Leben im Einklang mit den eigenen Werten zu führen. Engagiertes Handeln rundet das Hexaflex ab. Wenn ich mich mit meinen Werten und Zielen verbinde, dann hilft dies zu handeln, auch dann, wenn es schwierig wird.
Kontakt zu Christian Heiss:
https://performance-entwicklung.de/
Du möchtest deine mentalen Fähigkeiten verbessern:
Beschreibung:
Deine mentalen Fähigkeiten lassen sich trainieren. Dieses Buch zeigt dir wie!
Ob Wettbewerbs-, Streckenflug-, Akrobatikpilot oder noch Anfänger - für jeden bietet das Mentale Training Möglichkeiten sich zu verbessern und mehr Sicherheit beim Fliegen zu gewinnen. Leicht verständlich wirst du erfahren, was Mentales
Training ist und wie du es für dich anwenden kannst.
Ganz praktisch: Wann und wie, welches Training?
Fundiert: Auf Basis von achtsamkeitsbasierten Methoden, deren Wirkung wissenschaftlich erwiesen ist.
Nur wenige Minuten täglich: In nur wenigen Minuten täglich lassen sich Veränderungen nachweislich bewirken.
Noch mehr: Auf WinMental.de findest du weitere Audio-Dateien, Arbeitsblätter und Interviews von Toppiloten.
=> Weitere Informationen